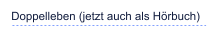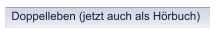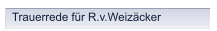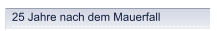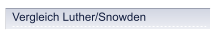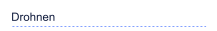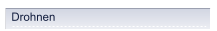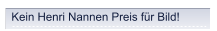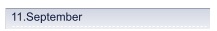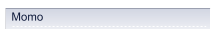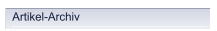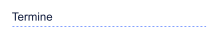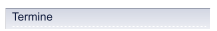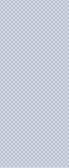
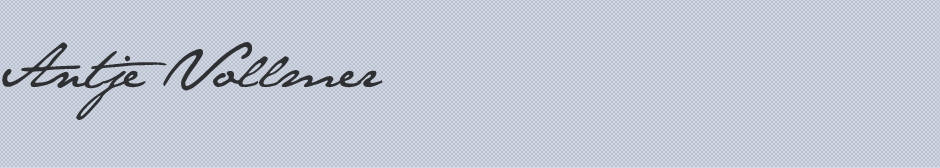





Laudatio Ibrahim Rugova (15.08.1999)
Dr. Antje Vollmer, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages
Laudatio anläßlich der Verleihung des
Toleranzpreises der Stadt Münster an
Ibrahim Rugova
Münster, 15. August 1999
Es gilt das gesprochene Wort.
I. Aktueller kann eine Preisverleihung nicht sein. Wir ehren heute einen Mann, dessen politische Existenz und dessen Lebenswerk genau mit dem europäischer Krisenzentren des Balkans verbunden ist, das uns seit Jahren in Atem hält und an dem es sich entscheiden wird, welch ein Europa wir im nächsten Jahrhundert bauen werden: ein Europa der Toleranz, des inneren und äußeren Friedens und der Menschenrechte - oder ein Europa der Intoleranz, der Kriege und Bürgerkriege, der religiösen und nationalistischen Ressentiments. Der Toleranzpreis der Stadt Münster erinnert an den Grundgedanken des Westfälischen Friedens von Münster und Osnabrück. Und was braucht Europa z. Zt. mehr als eine neue Einigung auf der Basis dieser Grundidee? Die Grundidee ist der große historische Kompromiß nach einem Jahrhundert der Spaltung, der religiösen Dogmatismen, der Machtkämpfe. Der Kompromiß beruft sich auf das gemeinsame große europäische Erbe, die Idee des Gleichgewichts, der Machtbalance, der gegenseitigen Akzeptanz, der Religionsfreiheit und des Respekts vor anderen Überzeugungen. In diesem Geist versuchten die damaligen Friedensstifter fair zu regeln, was unter Menschen überhaupt zu regeln ist. Den Rest, den Kampf um die letzen Wahrheiten, überließ man einer höheren Instanz. II. Zufällig ist es nicht, daß dieser große historische Kompromiß, der dem europäischen. Kontinent damals überhaupt das weltpolitische Überleben sicherte, nach 1989 wieder erneut zu einem europäischen Thema geworden ist. Das Ende des großen Dualismus zwischen Ost und West, zwischen Sowjetimperium und westlichen Marktwirtschaften, der Ruin der großen Ideologien hatte ja noch keineswegs eine neue gemeinsame Grundidee geschaffen, auf die sich das nunmehr ungeteilte Europa der vielen neuen Staaten hätte einigen können. Was war wirklich allen Europäern gemeinsam? Was war der europäische contract sociale? Was war ihr zivilisatorischer Konsens im Bezug auf den Umgang mit den real existierenden Unterschieden in Kultur, Religion, nationaler Identität, sozialen Standards, unterschiedlicher wirtschaftlicher Entwicklungen? Keiner konnte diese Frage beantworten und so agierten auch die führenden Staatsmänner der Wendezeit als ratlose Artisten unter einer Zirkuskuppel der gemeinsamen europäischen Arena, ohne den Bauplan für das neu zu bauende europäische Haus zu kennen. Kein Wunder, daß in dieser Ratlosigkeit alte Nothelfer als potentielle Ordnungsfaktoren sich anboten: der Nationalismus z. B., die religiöse und kulturelle Zugehörigkeit, ethnische Abgrenzungen, Gewalt als wieder erlaubtes Mittel, sich zum vermeintlichen Recht zu verhelfen, Grenzverschiebungen. All dies konzentrierte sich - wie in einem Brennglas - am meisten in der Region, die immer am deutlichsten den Grad der europäischen Krankheit und der europäischen Tragödien widergespiegelt hatte: auf dem Balkan. Und in diesem Spannungsfeld lebte, kämpfte, redete und handelte Ibrahim Rugova, unser heutiger Preisträger. III. Ibrahim Rugova ist ein Mann, an dem sich die Geister scheiden. Das war schon lange so - nicht erst seit den Tagen von Rambouillet. - Für die einen war er der Gandhi des Balkans, für die anderen war er ein politscher Traumtänzer. Und tatsächlich hat es etwas Kühnes, merkwürdig gegen den Geist der Zeit Gerichtetes, daß Ibrahim Rugova mitten im Zentrum des jahrtausende alten Konfliktfeldes des Kosovo, des Amselfeldes, eine gewaltfreie Bewegung aufbaute, die sich den Ideen Gandhis und Nelson Mandelas und Martin Luther Kings verpflichtet fühlte. Er wollte die Jugend des Balkan der Geschichte der Gewalt entziehen. Er nahm bitter ernst, daß an dieser uralten Bruchstelle zwischen Ostrom und Westrom, zwischen Islam und Christentum, zwischen osmanischem Reich und Mitteleuropa immer schon die Gefahr eines europäischen Steppenrandes gelauert hatte. Es war also ein Stück europäischer Verantwortung, alles zu versuchen, die Menschen dieses Raumes dieser Gewalttradition zu entziehen. Es war auch Teil der Klugheit, zu der gewaltfreie Bewegungen nie eine Alternative haben. Gewalt kann dumm sein, wenn sie nur genügend Waffen hat. Gewaltfreiheit muß immer klüger sein als der gewaltbereite Gegner. Mit der Methode der Gewaltfreiheit wollte Ibrahim Rugova auch die Gewaltbereitschaft des Milosevic-Regims unterlaufen, ihm keinen Anlaß zur offenen Eskalation bieten. Das ist ihm übrigens erstaunlich lange gelungen. Und daß es am Ende gescheitert ist, hatte die wenigsten Ursachen in der Strategie der Gewaltfreiheit. Doch dazu später mehr. Nicht zuletzt zielte die Strategie der Gewaltfreiheit langfristig und weitsichtig auf den frühen Aufbau einer Zivilgesellschaft in einer posttotalitären Gesellschaft. Ohne diese Zivilgesellschaft - das spüren wir in der ganzen Balkanregion - kann keine Demokratie existieren. Hier liegt eines der größten Verdienste der Bewegung um Rugova. Sie begann mit Organisationen der Selbstverwaltung und der Selbstorganisation, als anderenorts überwiegend über Grenzfragen und Nationalitätenfragen diskutiert wurde. Zehn Jahre lang, seit 1989, hatte die Bewegung um Ibrahim Rugova erstaunliche Erfolge: Auf die zunehmende Repression und Entrechtung reagierte sie mit positiven Erfahrungen des Aufbaus eigener Institutionen und Ordnungen. Eigene Universitäten und Schulen wurden erhalten, ein System eigener Sozialfürsorge, Parteien wurden aufgebaut und in einem koordinierenden Rat zusammengefaßt, Wahlen und Referenden wurden abgehalten. Eine erstaunliche politische und organisatorische Leistung, die im Westen kaum zur Kenntnis genommen wurde.
© 2015 Dr. Antje
Vollmer